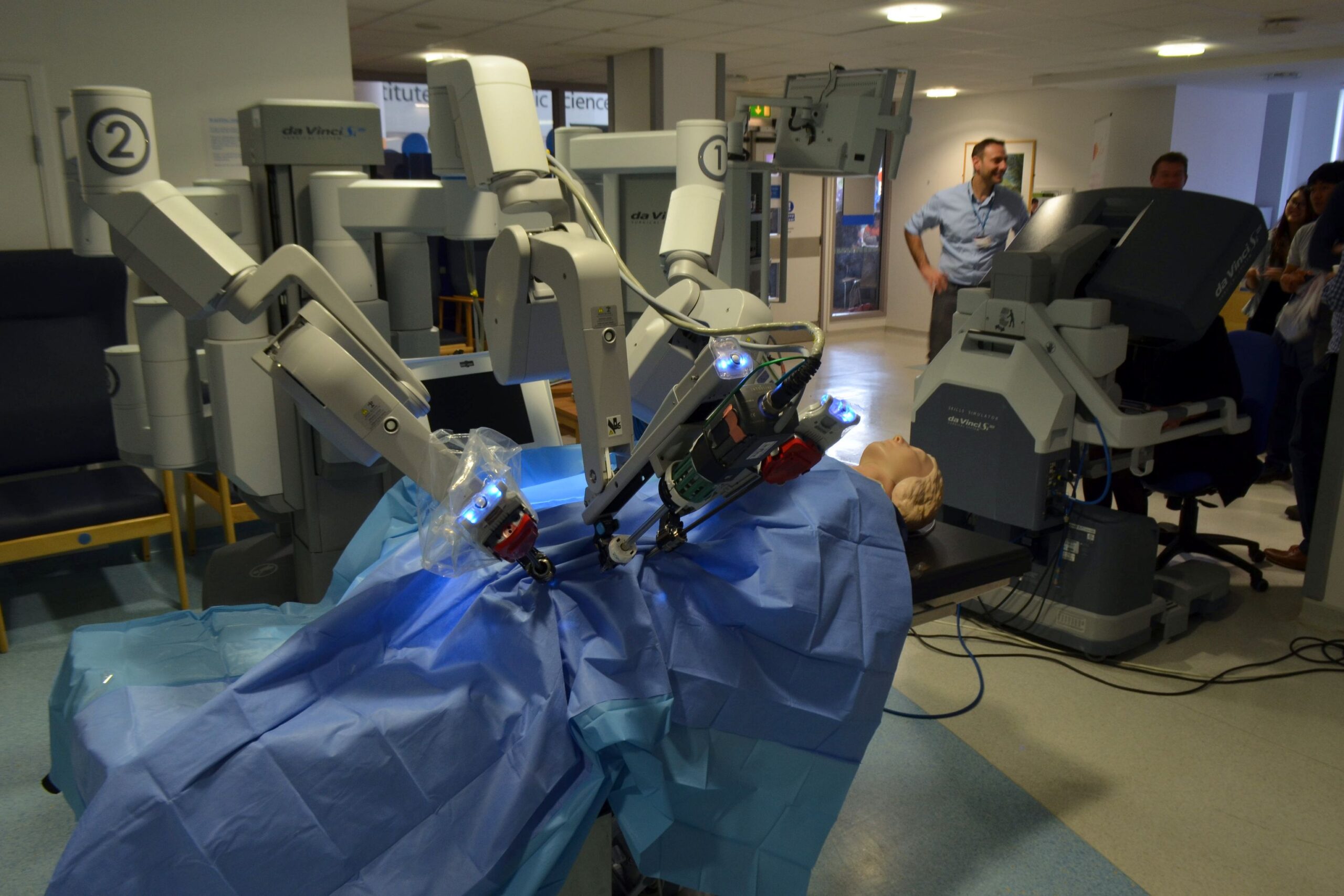Ein Sturz beim Sport oder auf dem Weg zur Arbeit. Danach schmerzt das Knie, die…

Das Ende der Krankenhausreform, wie wir sie erhofft hatten
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will das Projekt ihres Vorgängers Karl Lauterbach fortführen, aber mit zahlreichen Ausnahmen für die Kliniken. Tom Bschor, der frühere Leiter der Regierungskommission zur Krankenhausreform, befürchtet, dass Patienten zu kurz kommen.
„Für die Klinik ist das lukrativ, für Patienten riskant”
Herr Bschor, Sie haben knapp drei Jahre lang die Regierungskommission zur Krankenhausreform geleitet. Wie groß ist Ihr Vertrauen, dass die neue Gesundheitsministerin Nina Warken das 50 Milliarden Euro schwere Projekt erfolgreich abschließt?
Ich hatte bisher keine Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Als Bundesgesundheitsministerin ist sie sich ihrer großen Verantwortung für die Zukunft der Gesundheitsversorgung sicherlich bewusst. Dennoch habe ich Sorge, dass die Reform scheitert. Einflussreiche Interessengruppen, die vorgeben, sie voranzutreiben, wollen dem Vorhaben jede Kraft nehmen.
Das müssen Sie erklären. Wer will den Umbau der Krankenhauslandschaft scheitern lassen?
Zum Beispiel einige Bundesländer oder die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Sie drängen auf so vielen Aufweichungen, dass am Ende nichts mehr von der Reform übrig bleiben dürfte.
Sie reden wahrscheinlich von den umstrittenen Leistungsgruppen, die Kliniken künftig vorweisen müssen, damit sie Geld von den Krankenkassen bekommen. Die Vorgaben für diese Leistungsgruppen sollen noch in diesem Jahr gesetzlich verändert werden. Vieles deutet darauf hin, dass Ministerin Warken den Kritikern der Reform entgegenkommt.
Bedenklich ist, dass die ohnehin mauen Qualitätskriterien für die Leistungsgruppen aufgeweicht werden sollen. Derzeit braucht ein Krankenhaus, das beispielsweise Operationen an der Bauchspeicheldrüse abrechnen will, drei auf Eingeweidechirurgie spezialisierte Chirurgen oder Chirurginnen. Diese drei Ärzte dürfen bereits jetzt auf bis zu drei unterschiedliche Leistungsgruppen angerechnet werden, sodass die Klinik zwei weitere Arten von chirurgischen Eingriffen abrechnen darf. Diese Begrenzung soll nach dem Wunsch einflussreicher Gruppen komplett wegfallen. Dann reichen drei spezialisierte Ärzte für sämtliche Operationen an den Bauchorganen.
Hieße das: Jemand kommt etwa wegen Lungenkrebs ins Krankenhaus und wird im Zweifel von einem unerfahrenen Arzt operiert, der keine besondere Fachkenntnis auf dem Gebiet hat?
Dieses Qualitätsproblem betrifft besonders die sogenannte Viszeralchirurgie, also etwa Eingriffe an Leber, Bauchspeicheldrüse oder Speiseröhre. Wenn die immer gleichen drei Spezialisten auf das gesamte Leistungsspektrum der Viszeralchirurgie angerechnet werden, ist das für die Patienten gefährlich. Und drei Fachärzte reichen auch einfach nicht, um für ein so breites Spektrum an 365 Tagen rund um die Uhr den Qualitätsstandard zu garantieren.
Gibt es neben der Aufweichung der Leistungsgruppen weitere Entwicklungen, die Sie problematisch finden?
Der sogenannte Grouper, eine wichtige Software, die ermittelt, in welche Leistungsgruppe ein Behandlungsfall fällt, soll womöglich abgeschafft werden. Dann könnten Behandlungen weiterhin durchgeführt werden, auch wenn das Krankenhaus nicht die erforderliche Spezialisierung hat. Verirrt sich etwa, was gar nicht so selten passiert, ein Patient mit Bauchspeicheldrüsenkrebs in die Allgemeinchirurgie, kann er ohne Grouper dort operiert werden. Für die Klinik ist dies wirtschaftlich lukrativ, für den Patienten aber riskant. Komplikationen und Sterblichkeit sind bei solchen Gelegenheitseingriffen deutlich höher. Als wäre das nicht genug, wollen einige Bundesländer auch noch einzelne Krankenhäuser per Verwaltungsbescheid für unverzichtbar erklären. Diese Häuser sollen komplett von Qualitätsvorgaben befreit werden, auch das wieder zu Lasten der Sicherheit der Patientinnen und Patienten.
Die Krankenhauskommission hat schon früh darauf hingewiesen, dass in Deutschland viele Menschen unnötig früh sterben, weil sie in ungeeigneten Kliniken behandelt werden …
Das lässt sich mit statistischen Mitteln gut belegen. Nur ein Beispiel: Werden Menschen mit einer Krebsdiagnose in zertifizierten Krebszentren behandelt, leben sie nach der Behandlung im Schnitt deutlich länger, als wenn sie andere Häuser aufsuchen. Pro Jahr könnten wir in Deutschland über 20.000 Lebensjahre retten, würden ungeeignete Kliniken auf Krebstherapien verzichten.
Zum Teil gehen jetzt kleine, wenig spezialisierte Krankenhäuser Kooperationen mit anderen Einrichtungen ein, um Leistungsgruppen beanspruchen zu können. Ist das eine Lösung?
Kommt darauf an. Natürlich ist es sinnvoll, wenn beispielsweise Labore zusammen genutzt werden. Eine Intensivstation nutzt einem Patienten mit Komplikationen aber nur, wenn sie im Haus ist. Hinzu kommt, dass Kooperationen drohen, die lediglich für die Prüfbehörden in der Schublade liegen, obwohl die Häuser in der Realität kaum zusammenarbeiten.
Die Bedenken, die Sie äußern, lassen befürchten, dass wir am Ende 50 Milliarden Euro an Steuergeldern in ein ineffizientes System geben, von dem die Leistungserbringer profitieren, die Versicherten aber weniger.
Das muss verhindert werden. Und zu den 50 Milliarden kommen voraussichtlich vier Milliarden Euro schuldenfinanzierte Sofortunterstützung, die ohne Prüfung der Bedarfsnotwendigkeit oder Vorgaben zu Qualität oder Strukturveränderungen an sämtliche Krankenhäuser verteilt werden soll.
Karl Lauterbach warnte in seiner Zeit als Minister, ohne eine sinnvolle Krankenhausreform komme es zu einem ungeordneten Sterben der Einrichtungen. Besteht diese Gefahr weiterhin?
Sie ist ziemlich real. Der Hauptgrund dafür ist gar nicht einmal das Geld, sondern der Fachkräftemangel. Ein Krankenhaus ist nun einmal besonders personalintensiv. Umso wichtiger wäre es, dass Pflegerinnen und Pfleger, die jetzt ihre Ausbildung absolvieren, ihre Laufbahn nicht in Einrichtungen beginnen, die keine Zukunft haben.
Wie viele Krankenhäuser könnten wir in Deutschland nach Ihrer Einschätzung entbehren?
Mein Kollege Christian Karagiannidis schätzt, dass selbst bei Verzicht auf etwa 500 unserer rund 1700 Kliniken eine gut erreichbare, hochqualitative Versorgung der Bevölkerung möglich ist. Nehmen Sie Nordrhein-Westfalen: In den Ballungszentren des Landes kommt man, flapsig gesprochen, mit dem Rollator von einer Klinik in die nächste. Oder Berlin: Ich konnte von meinem früheren Arbeitsplatz im Bezirk Wedding in ein paar Schritten zu zwei weiteren Krankenhäusern gehen. Später habe ich im Bezirk Charlottenburg gearbeitet und konnte fast direkt auf ein anderes Krankenhaus sehen. Beide Häuser halten eine 24-Stunden-Herzkatheter-Notfallversorgung vor. Wenn eine wegfallen würde, würde sich die Versorgung der Charlottenburger Bevölkerung nicht verschlechtern. Die vielen Krankenhäuser nehmen sich gegenseitig Personal und Patienten weg. Fast 30 Prozent der Krankenhausbetten stehen leer.
Einer der Befürworter der Krankenhausreform, der frühere Abteilungsleiter Michael Weller, ist seinen Job mittlerweile los. Hat sich Ministerin Warken mit Ihnen irgendwann einmal über die Reform ausgetauscht?
Nein.
Die Regierungskommission hat ihre Aufgabe im März abgeschlossen. Was heißt das für Ihre Zukunft im Gesundheitsministerium?
Mir wurde vor kurzem mitgeteilt, dass mein Job zum 30. Juni endet.
Frau Warken hat Ihnen mitgeteilt, dass Ihre Arbeit entbehrlich ist?
Ich bekam einen Brief mit meiner Kündigung.