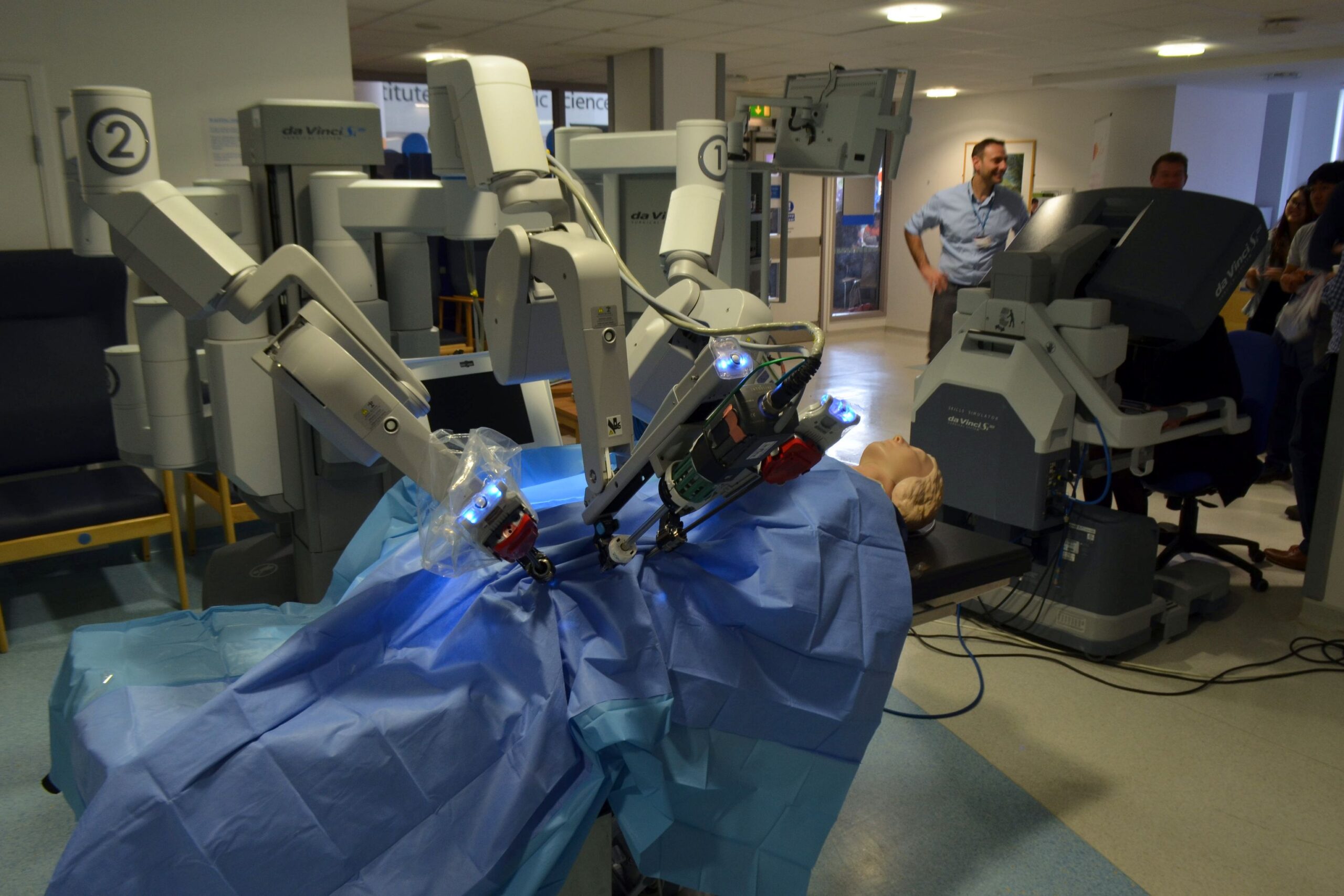Auch wenn sie nicht immer offen darüber sprechen, nutzen viele Ärzte digitale Hilfe für Diagnosen…

Das Primärarztsystem: Angst vor „spürbaren Qualitätsproblemen“
Ein Sturz beim Sport oder auf dem Weg zur Arbeit. Danach schmerzt das Knie, die Wade oder der Fuß. Schnell zum Orthopäden, damit der ausschließt, dass Knochen oder Muskulatur ernsthaften Schaden genommen haben?
Geht es nach der Regierungskoalition, den Hausärzten und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (Foto), wird das für gesetzlich Versicherte bald nicht mehr möglich sein. Künftig sollen Kassenpatienten auf jeden Fall erst einmal im Wartezimmer eines Allgemeinmediziners landen. Ausnahmen sind nur für Beschwerden geplant, um die sich Frauen- oder Augenärzte kümmern, oder bei chronisch Kranken. Aktuell ist Warken zu diesem Vorhaben im Dialog mit Kassen und Berufsverbänden. Noch in diesem Jahr will sie einen Referentenentwurf präsentieren.
Auf Patientinnen und Patienten kommen spürbare Änderungen zu. Ziel ist es, die durchschnittliche Zahl von Arztkontakten eines jeden Versicherten zu reduzieren – und das bei einer Bevölkerung, die altert und damit immer kränker wird. Fast zehnmal im Jahr gehen Bundesbürger im Schnitt zum Arzt, so eine OECD-Statistik aus dem Jahr 2021. Nur die Slowakei verzeichnete höhere Zahlen. In Frankreich waren es nur 5,5 Arztkontakte pro Jahr.
Versicherte sollen seltener in die Praxis kommen
Damit das deutsche Gesundheitssystem in dieser Hinsicht künftig tickt wie das französische, müssen Hausärzte den Versicherten künftig häufig mitteilen, dass ein Facharzttermin für sie nicht infrage kommt. Für gute Laune dürfte das nicht immer sorgen. Die Befürworter eines Hausarztsystems wenden ein, dass für die Patientinnen und Patienten, deren Beschwerden als tatsächlich dringend eingestuft werden, dann wenigstens zeitnah Facharzttermine frei wären. Eine zentrale Terminvergabe, wie jetzt schon über die Notfall-Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigungen bietet, soll dies sicherstellen.
Viele Fragen sind noch offen. Beispielsweise diese: Können die Hausärzte die künftigen zusätzlichen Terminanfragen ohne lange Wartezeiten für die Patienten bewältigen? Ja, heißt es beim Hausärztinnen- und Hausärzteverband. Pro Tag und Hausarztpraxis handle es sich aller Voraussicht nach um zwei bis fünf zusätzliche Patientenkontakte. „Uns fehlen in Deutschland 5000 Hausärzte“, gibt dagegen der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Klaus Stefan Holler, Vorsitzender des Bayerischen Facharztverbandes, zu bedenken.
Reichen die Kapazitäten in den Hausarztpraxen?
Versicherte, die zeitnah einen Hausarzttermin brauchen, müssen heute schon damit leben, nicht zum Wunsch-Mediziner, sondern in eine andere Praxis gehen zu müssen. Auf dem Land kann es sein, dass Menschen ohne Pkw viele Tage oder gar Wochen auf einen Termin in einer für sie erreichbaren Praxis warten. „Wenn Versicherte primär immer erst vom Hausarzt gesehen werden, besteht das Risiko, dass Diagnosen unter den Tisch fallen und ernsthafte Erkrankungen zu spät behandelt werden“, sagt Holler. Dies sei bereits „traurige Realität“, beispielsweise bei Hörstürzen
Dem drohenden Engpass in den Hausarztpraxen will Gesundheitsministerin Nina Warken begegnen, indem sie die Arbeit auf mehr Schultern verteilt. „Advanced Practice Nurses“ (akademisch ausgebildete Pflegeexpertinnen) sollen Aufgaben übernehmen, die bisher Hausärzte erledigen.
Prinzipiell haben die Allgemeinmediziner nichts dagegen und ermutigen auch ihre Praxishelferinnen, sich weiterzubilden. Wichtig ist den Hausärzten nur, dass sie und nicht etwa eine Apotheke um die Ecke die Versorgung der Patienten koordinieren. Und natürlich kostet die zusätzliche Ausbildung der neuen Kräfte Geld. Den Kassen müsse das klar sein, heißt es bei den Hausärzten.
Ist es das wirklich? Bisher wird das Primärarztsystem immer wieder als ein Königsweg zu einer preisgünstigeren medizinischen Versorgung beschrieben. Geschätzt 14 Milliarden Euro fehlen 2027 im deutschen Gesundheitssystem. Ideal aus Sicht der Regierung wäre es, wenn ein Primärarztsystem wenigstens helfen könnte, ein paar Milliarden Euro im Jahr einzusparen. Aber die Angaben zu den finanziellen Auswirkungen sind widersprüchlich.
Das Sparpotential? Muss sich zeigen. Erst einmal kostet das neue System
Als Beleg dafür, dass der Zwang zum Gang in die Hausarzt-Praxis Geld spart, werden Studien aus Baden-Württemberg zitiert. Dort gibt es seit über zehn Jahren eine Reihe von Hausarzt- und Facharztverträgen, für die sich Patientinnen und Patienten freiwillig entscheiden können.
Die Hausärzte schätzen an diesen Verträgen, dass sie viel Raum für die „sprechende Medizin“ lassen. Die teilnehmenden Mediziner müssen nicht eine Vielzahl von teils unsinnigen Untersuchungen und Therapien abrechnen, um auf ihre Kosten zu kommen. Unterm Strich verdienen sie deutlich besser als andere Hausärzte. Für die Allgemeinheit heißt das erst einmal: Höhere Kosten.
Trotzdem seien auch für Patienten und für die Kassen die Vorteile groß, wird argumentiert: Unter anderem habe in Baden-Württemberg die Zahl der Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz, die den Notarzt und eine Noteinweisung ins Krankenhaus brauchten, signifikant verringert werden können. Zwar hätten die Kassen mehr Geld für die Versorgung durch die Primärärzte ausgeben müssen. Dafür seien andere Ausgaben für vermeidbare gesundheitliche Schäden gesunken.
Rheuma-Liga befürchtet „irreversible Folgeschäden“
Aber lassen sich die Erkenntnisse aus der Behandlung genau definierter Patientengruppen mit vergleichbaren Krankheitsverläufen auf die Gesamtbevölkerung übertragen? Die Liste der Skeptiker ist lang. Die BAG Selbsthilfe, der Deutsche Behindertenrat, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen, die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen und der Verbraucherzentrale Bundesverband warnen vor dem Ende der freien Arztwahl.
Die Deutsche Rheuma-Liga befürchtet, dass Patienten bei akuten Schüben künftig „irreversible Folgeschäden“ erleiden, weil sie im Zweifel in einem Primärarztsystem keine sofortige Hilfe bekommen. Die frühere Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Ruth Hecker, erwartet ebenfalls Fehldiagnosen.
Vera Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, wendet sich gegen die Vorstellung, Patientinnen und Patienten würden ohne Sinn und Verstand Arzttermine in Anspruch nehmen: „Wer Hilfe sucht, benötigt Hilfe, keine Strafe.“ Die Ursache für zu viele Arztkontakte sei kein massenhaft praktiziertes ‚Ärztehopping‘, sondern ein „auf Gewinnmaximierung ausgerichtetes System, das schlecht koordiniert ist“.

Vera Bentele: „Auf Gewinnmaximierung ausgerichtetes System“. Foto: Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons
„Die hausärztlichen Kollegen verfügen nicht immer über die Kompetenzen, um alle Patienten sicher zu behandeln“, sagt Facharzt-Funktionär Klaus Stefan Holler. Tatsächlich sind alle niedergelassenen Ärzte zwar verpflichtet, sich regelmäßig fortzubilden – welche Fortbildungen sie belegen, ist ihnen aber weitgehend selbst überlassen.
So kann es sein, dass ein Patient bei der nächstgelegenen Hausarztpraxis auf eine überaus engagierte und versierte Medizinerin trifft, oder auf einen Arzt, der nicht besonders viel Energie darauf verwendet, sein Wissen up to date zu halten. „Derzeit gibt es im ambulanten Bereich nur wenige Möglichkeiten, sich verlässlich über die Versorgungsqualität einer Praxis oder eines Versorgungszentrums zu informieren“, monieren die Patientenverbände. Dass sich dies in absehbarer Zeit ändert, ist nicht zu erwarten.
Freie Facharztwahl für bis zu 800 Euro Eigenanteil im Jahr
CDU und SPD kennen die Bedenken, werden das Primärversorgungs-Modell aller Voraussicht nach aber trotzdem realisieren. Es könnte eines der wenigen Vorhaben werden, bei dem die Koalition Einigkeit und Entschlusskraft signalisiert.
Unklar ist, wie Fälle geregelt werden, in denen Kassenpatienten sich partout nicht auf das neue Hausarztsystem einlassen wollen. Im Gespräch sind Boni bzw. Extra-Gebühren, wenn Patienten doch direkt zum Facharzt gehen.
Zudem dürften neue Zusatztarife bei den Kassen entstehen. Der Bayerische Facharztverband hat bereits einen Wahltarif mit der Innovationskasse IK aufgesetzt. Interessenten, die ihn buchen, können künftig beim Facharzt als Privatpatient auftreten. Dann kann es ihnen egal sein, ob der Hausarzt eine Überweisung für sinnvoll hält oder nicht. Sie bekommen sogar eine jährliche Prämie von 400 Euro.
Die finanzielle Kehrseite: ein Selbstbehalt von bis zu 800 Euro pro Jahr. Attraktiv dürfte der Tarif vor allem für kerngesunde Menschen sein – oder für Versicherte, die nicht auf jeden Euro und Cent sehen müssen. „Dieser Zusatztarif stärkt die Selbstverantwortung der Patienten“, sagt HNO-Arzt Klaus Stefan Holler. „Eine Wahlmöglichkeit mit Eigenbeteiligung sollte in einer liberalen Demokratie selbstverständlich möglich sein.“