Während andere Krankenhäuser pleitegehen, erzieht die Klinikkette Helios, Marktführer in Deutschland, gute Erträge. Wie ist…

Deutsche Bahn: „Geld versickert im System“
Er ist wieder da. Claus Weselsky, der Gottseibeiuns der Deutschen Bahn, sitzt in einem Besprechungsraum im Hotel „Neuer Fritz“ in Berlin-Mitte, schüttelt Journalistenhände und gibt den Polemiker wie in seinen besten Zeiten ab als Chef der Lokführergewerkschaft GdL. Seit dem vergangenen Herbst hat er das Feld seinem nicht minder kämpferischen Nachfolger Mario Reiß überlassen. Aber Reiß ist gerade in Urlaub, und Weselsky ist sowieso immer noch, wie er sagt, als „Teilzeit-Lobbyist“ unterwegs. Deswegen ist er aus seinem Zuhause im malerischen Spreewald in die Hauptstadt gekommen. An seiner Seite sitzt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Branchenverbandes der privaten Güterbahnen, die in einer unbequemen Symbiose mit der Bahn stehen. Einerseits machen sie ihr Konkurrenz, andererseits sind sie auf ihr Schienennetz angewiesen. GDL und Güterbahnen, beide pochen auf einen Neuanfang beim Staatskonzern DB.
Es sind weitere Personalien erforderlich
Jetzt, wo Noch-Vorstandschef Richard Lutz öffentlich demontiert wurde, könnten die Karten neu gemischt werden, hoffen Weselsky und Westenberger. Im Verkehrsministerium wird hinter verschlossenen Türen an einem neuen Konzept für die Bahn getüftelt. Am 22. September will Verkehrsminister Patrick Schnieder seine Strategie für die Neuaufstellung des Konzerns vorstellen. Möglicherweise kann er dann auch schon einen Nachfolger für Lutz nennen – oder sogar mehrere Nachfolger für weitere Vorstände.
Die Gewerkschafter hätten nichts gegen einen gründlichen Kehraus in den Chefetagen. „Es sind weitere Personalien erforderlich“, sagt Weselsky. Wozu brauche es einen siebenköpfigen Vorstand an der Spitze? „Auf Konzernebene benötigen wir im Grunde nur einen Vorstandschef und einen Finanzvorstand“, so Weselsky. „Alles, was von Belang ist, spielt sich sowieso in den Aktiengesellschaften darunter ab.“
Mit den privatwirtschaftlichen Konkurrenten der Logistik-Sparte DB Cargo versteht sich die GDL gut, besser jedenfalls als mit der Bahn. Die privaten Firmen zahlen Lokführer vielfach deutlich besser als die Bahn, und sie fahren keine Anti-GDL-Linie wie der Staatskonzern DB. Dort hat die Eisenbahngewerkschaft EVG mehr Mitglieder und Posten als die GDL. Vehement wehrt sie sich gegen alle Versuche, die Deutsche Bahn zu zerschlagen. Für die GDL und die privaten Güterbahnen bedeutet das Stillstand pur. „Wir wollen, dass sich die Struktur des Konzerns ändert“, sagt Weselsky. Ähnlich sieht es Peter Westenberger.
Ein verschachteltes Firmensystem
Die privaten Bahnen müssen an den Staatskonzern eine Art Maut zahlen, wenn sie das Schienennetz benutzen. Im internationalen Vergleich sind diese Trassenpreise ziemlich hoch. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass die Bahn von ihrer eigenen Infrastrukturgesellschaft InfraGO Zinsen für das Kapital verlangt, das sie in das Schienennetz investiert. Klingt tricky. In den Augen der Lokführer und der Privatbahnen ist das Teil eines undurchsichtigen Systems von gegenseitigen Abhängigkeiten unter den Bahn-Sparten, mit dem sich der gesamte Konzern einer öffentlichen Kontrolle entzieht.
„Die Bahnsparten müssen Dienstleistungen und Produkte bei Konzernschwestern beziehen“, sagt Weselsky. Oft passiere das zu überhöhten Preisen. „So versickert Geld im System.“ Dazu kommen Doppelfunktionen. Der DB Konzern hat einen Vorstand und einen Aufsichtsrat, seine Sparten jeweils auch. Aufsichtsratschef der wichtigen InfraGO ist Berthold Huber, der außerdem im Vorstand der InfraGO-Mutter DB AG sitzt. „Dort entscheidet Huber nicht öffentlich zusammen mit den Spitzen der DB-Verkehrsgesellschaften über Vorhaben und Budget der DB InfraGO aufgrund des sogenannten Beherrschungsvertrages“, sagt Peter Westenberger. „Wie sollen da eine Gemeinwohlorientierung und Wettbewerbsneutralität garantiert werden?“
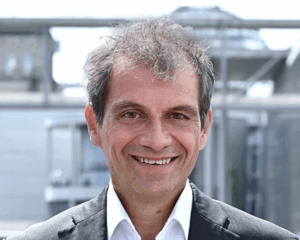
Güterbahnen-Lobbyist Westenberger
Der Güterbahnen-Lobbyist bezweifelt, dass überhaupt irgendjemand bei der Schienensparte durchblickt. Das Bundesverkehrsministerium? „Hat nicht das Personal oder die Instrumente zur Steuerung von InfraGO, wie sie heute organisiert ist“, so Westenberger. Das Eisenbahnbundesamt? „Hat nur eingeschränkte Kompetenzen.“ Dasselbe gelte für die Bundesnetzagentur. Die Folge seien wundersame Kostensteigerungen. Im Netzzustandsbericht für 2024, so Westenberger, habe die DB die aufgeschobenen Investitionen um 30 Milliarden Euro höher als 2023 taxiert. „Der Anstieg wurde nur auf Nachfrage und nur lapidar mit ‚Preissteigerungen‘ begründet“, berichtet Westenberger. Die Steigerungen bei der Bahn hätten allerdings „meilenweit“ über der Teuerungsrate der Baupreise gelegen.
Es sei Zeit für eine Umwandlung der Netzgesellschaft in eine GmbH, finden er und Weselsky. Die Rechtsform erleichtere anders als die AG den Durchgriff, argumentiert Weselsky: „Einem GmbH-Geschäftsführer kann man direkte Ansagen machen.“
Hohe Erwartungen an Patrick Schnieder
Jetzt setzen Weselsky und Westenberger auf den Bundesverkehrsminister. Anders als seine Vorgänger habe der sich nicht von den Bahn-Vorständen um den Finger wickeln lassen, freuen sie sich. Gerade erst wurde allerdings bekannt, Patrick Schnieder wolle die Ressorts des Finanz- und des Infrastrukturvorstandes auf Konzernebene zusammenlegen. Ein „Placebo“ kommentiert Westenberger den Schritt enttäuscht. Die Idee helfe niemandem, sagt er. „Wie bisher würde der DB-Konzernvorstand und nicht der Bund die Infrastruktur faktisch steuern.“ Und der Konzernvorstand sei vor allem auf die eigenen Pfründe und nicht aufs Gemeinwohl aus.
Erwarten Westenberger und Weselsky am Ende zu viel von der Regierung? Patrick Schnieder muss mit der SPD rechnen. Für die ist die Bahn in ihrer jetzigen Form wichtig, weil sie es sich nicht mit den gut 200.000 Beschäftige in Deutschland verscherzen will. Die Union dagegen hat im Wahlkampf versprochen, die Bahn neu aufzustellen. Im Koalitionsvertrag steht als Kompromiss: „Wir werden die DB InfraGO vom DB-Konzern weiter entflechten, innerhalb des integrierten Konzerns.“ Das heißt: Zerschlagung nein, größere Selbständigkeit für die Schiene ja.
Wie Schnieder diesen Satz interpretiert, wird sich am 22. September zeigen. Claus Weselsky gibt sich optimistisch: „Seit dem Amtsantritt von Minister Schnieder habe ich die Hoffnung wieder aktiviert.“



